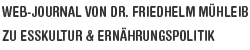Drei Schulen, drei Welten – eine Lehrerin erzählt in der WELT vom vergangenen Samstag, wie sehr sich der Alltag an den drei Orten, an denen sie unterrichtet hat, unterscheidet. Was sie über ihre Zeit in der Schule im sozialen Brennpunkt einer deutschen Großstadt berichtet, ist ein erschütterndes Dokument. Sie begegnet dort einem unglaublichen „Hunger nach Liebe und Aufmerksamkeit“, den sie als größten Unterschied zu den Kindern in den Speckgürtelschulen der (ungenannten) Stadt wahrnimmt. Sie erzählt, wie sie belagert und von ganz fremden Kindern umarmt wurde, wenn sie in eine neue Klasse kam: „Es konnte passieren, dass Kinder, die ich noch nie gesehen hatte, zu mir sagten: ‚Du siehst aus wie ein Engel.‘ Kinder ohne Defizite verhalten sich nicht so, sie haben ein natürliches Gespür für angemessenen Abstand. Diese Kinder nicht. Sie kriegen zu Hause wenig und holen sich die Liebe dann von überall, von jedem der vorbeikommt. Die Schwierigkeit bestand dann …in der richtigen Dosierung von Nähe und Distanz.“
 Die Zukunft der Schule? Hoffentlich nicht!
Die Zukunft der Schule? Hoffentlich nicht!
Neben Lerndefiziten, Verhaltensstörungen, Missbrauch und Gewalt im familiären Umfeld und sozialen Problemen scheinen die gesundheitlichen, hygienischen und versorgungsbezogenen Defizite der Kinder, von denen die Lehrerin berichtet, fast nachrangig zu sein. Trotzdem: „Sauberkeit, Hygiene, Ernährung, Zähneputzen – da haperte es. Viele Kinder hatten verfaulte Zähne, sie putzten sie nie.“ Die Unmöglichkeiten begannen schon morgens, erinnert sich die Erzählerin. Pünktlich mit dem Unterricht anzufangen, ging oft nicht. Viele kamen zu spät, weil niemand sie weckte, ihnen niemand Brote schmierte. Viele Kinder waren auf sich selbst gestellt. Schließlich führte sie ein gemeinsames Frühstück ein. „Es hat Monate gedauert, ehe ich es den Eltern klar gemacht hatte, dass sie ihren Kindern etwas Gesundes mitgeben sollten, also dass Chips oder Süßigkeiten nicht gesund sind. Nichts konnte man als selbstverständlich voraussetzen, das habe ich lernen müssen. Die Erfolge waren dann besonders schön.“ Sie erinnert sich: „Irgendwann hatte fast jedes Kind Obst und Vollkornbrot dabei. Statt Cola tranken wir irgendwann wirklich Wasser oder Apfelschorle. Manche machten schon den nächsten Schritt: den Apfel in Stücke schneiden, weil es liebevoll ist und besser schmeckt.“ Immerhin.
Für mich, dessen Schulzeit ein halbes Jahrhundert zurückliegt, und dessen Kinder erwachsen sind, wirkt der Bericht wie eine Erzählung von einem anderen Planeten. Schrecklich, traurig, verstörend, unfassbar (… und dies sicher am wenigsten wegen der Ernährungsthemen). Lest ihn, spürt ihn und leitet ihn an jeden Bildungspolitiker in Bund, Ländern und Kommunen weiter, den Ihr kennt. Das Stück sollte Pflichtlektüre für jeden Politiker werden, der sich derzeit in Berlin mit der Bildungspolitik der kommenden Koalition beschäftigt. Die Politik muss verstehen, dass es neben der besseren Vorbereitung der jungen Menschen auf die Anforderungen der Digitalisierung noch eine weitere Herkulesaufgabe gibt. Eine, die noch elementarer ist: Schule muss sich um die Abgehängten, die Armen, die Mühseligen unter den Jungen kümmern. Wenn wir es nicht schaffen, die mitzunehmen, ist unsere schöne heile Wohlstandswelt früher oder später verloren.
Damit übrigens kein falscher Verdacht aufkommt: Bei den Kinder, von denen sie redet, handelt es sich keineswegs nur um Migranten: „Etwas mehr als die Hälfte hatte Migrationshintergrund. Aber die meisten waren in Deutschland geboren. Die Eltern und Großeltern meistens auch schon.“
Zum Artikel in der WELT: Eine Lehrerin berichtet „Ich hatte Angst vor den Eltern“
Photo: © Enda O Flaherty