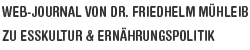Stell Dir vor, da ist ein Supermarkt – und nichts mehr ist drin. Diese Vorstellung dürfte den meisten geradezu absurd erscheinen. Auf irgendeinem Radiosender wird ein deutscher Student in Tokyo gefragt, welche einschneidenden Veränderungen es gebe, mit denen er jetzt nach dem Beben fertig werden müsse. Antwort: „Die Supermärkte sind leer. Es ist unfassbar: Du kommst in den Supermarkt, und da gibt es nichts mehr. Kein Wasser, kein Reis, keine Konserven, kein Obst und Gemüse – die Regale sind einfach leer. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wo ich was zu essen herkriegen soll.“ Was für eine Erfahrung. Wer von uns hätte sie schon gemacht? Und das, obwohl der Homo Sapiens seine ersten 150.000 Jahre auf diesem Planeten ohne Supermärkte auskommen musste. 60 Jahre Supermärkte in Deutschland haben ausgereicht dafür, dass sich kaum noch jemand vorstellen kann, wo das Essen herkommen könnte, wenn nicht aus dem Supermarkt – alles immer und zu jeder Zeit.
Bei aller berechtigten Kritik an manchen Auswüchsen der modernen Lebensmittelproduktion weiß kaum jemand die unglaubliche logistische Leistung zu würdigen, die damit verbunden ist, täglich 80 Millionen Menschen bis zum letzten Einsiedler im hintersten Winkel mit allem zu versorgen, was das Konsumentenherz begehrt. Was ein Glück, das so was wie in Japan bei uns nicht passieren kann! So kommt es unisono in den letzten Tagen aus den Sprechblasen der grauen Herren der Atomlobby. Beruhigend, das zu wissen. Die Versorgung mit Lebensmitteln hängt auch bei uns an dünnen Fäden – z.B. an intakten Straßen, an einer intakten Infrastruktur. Die Bewohner der Städte sind abhängig davon. Der Hunger würde nicht warten, bis der Asphalt aufgehackt ist und die ersten Kartoffeln wachsen. Stünden eines Tages die Räder der LKW’s still – sagen wir mal, wegen einer Ölkrise – würden sich die Regale innerhalb weniger Tage leeren. Aber was für ein Glück, dass das bei uns nicht passieren kann. Und wenn doch? Das wäre unfassbar. Ich wüsste nicht, wo ich dann was zu essen herkriegen sollte.
Und dann fallen mit die Geschichten meiner Großmutter ein, wie sie vor nicht einmal 70 Jahren mit dem Leiterwagen aus der Stadt aufs Land zog – morgens um 5 Uhr in der Früh 15 Kilometer hin, bis in die Nacht hinein 15 Kilometer zurück, um Schmuck und Teppiche gegen Mehl und Kartoffeln einzutauschen. Und wie dann auch noch aus den letzten Kartoffelschalen Suppe gekocht wurde. Aber zum Glück kann so was bei uns ja nicht passieren. Wo es keine Alternativen gibt, ist Verdrängen vielleicht die beste Lösung.